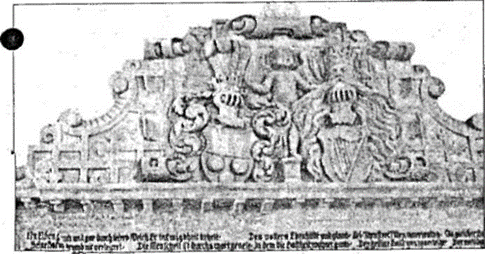RINGINGEN (vf) – Eine Gruppe Ringinger hat sich zur Gründung einer neuen Narrenzunft zusammengetan, eine Fasnetsfigur namens „Spuler-Weible“ erkoren und einen Vorstand gewählt. – Vorsitzende ist Bettina Wollin, 30 Jahre alt, Hausfrau, Mutter zweier Kinder, seit sieben Jahren in Ringingen wohnend, aufgewachsen in Blaubeuren und Ulm. Stellvertretender Vorsitzender ist Peter Blanz, Zunftschreiberin Renate Knab, Kassier Günter Wollin.
Die Narrengruppe hat sich als Figur und Maske das „Spuler-Weible“ zugelegt. Das „Spuler-Weible“ existiert in der Dorfgeschichte nicht, sehr wohl aber eine Anna Spuler, die Anfang des 16. Jahrhunderts gelebt hat und durch ihr Leben und ihr Schicksal eine der ungewöhnlichsten deutschen Frauen ihrer Zeit war (auch wenn‘s hierherum kaum einer mitgekriegt hat).
Wer heute eine Narren-Maskengruppe gründet und das in Anpassung an das Narrenwesen unserer Region tun möchte, darf nicht eine Gruppe – meinetwegen – „Ringinger Cowboys“, „Allmendinger Zauberer“ oder „Ehinger Kurzholz-Zimmerer“ gründen, er muss in der Geschichte der Region, des Dorfs, der Stadt herumwühlen und – mag das Ergebnis, wie etwa vergangenes Jahr in Rottenacker – noch so verzweifelt ausfallen – er muss eine historische oder legendäre Person oder Personengruppe zu Tage fördern, die dann die Leitfigur des örtlichen „Brauchtums“ (wie man das tatsächlich nennt) abgeben soll.
Bettina Wollin hat nun in einer maschinenschriftlich vorliegenden Dorfchronik geblättert und da fiel ihr (passend zu den in der schwäbisch-alemannischen Fasnet so beliebten Hexenfiguren) die Geschichte der Ringingerin Anna Spuler auf (oder, wie es damals hieß, mit weiblicher Endung) Spulerin. Bettina Wollin war und ist der Meinung, dass diese Person nicht noch mehr in Vergessenheit bleiben, geraten, sondern aus der Vergessenheit herausgeholt werden sollte. Dies geschieht jetzt, nach Meinung von B. Wollin in angemessener Weise durch die Umwandlung von A. Spuler in eine Fastnachtsfigur und durch Anhängen des Verkleinerungssilbe „le“ an das Wort „Weib“, zu „Spuler-Weible“.
Die Ringinger Narretei-Gründer haben den richtigen Riecher gehabt, als sie eine ungewöhnliche Frau „ausgegraben“ haben, eine Frau, auf die der Verfasser dieser Zeilen, wenn er sich recht erinnert, vor Jahren in einem SZ-Text hinwies, die aber ansonsten, sprichwörtlich gesprochen: bisher leider keinen Hund hierherum hinterm Ofen hervorlockte.
Die Spuler-Geschichte in der Geschichtswissenschaft
Aber A. Spuler ist nicht ganz unvergessen geblieben. Das 19.-Jahrhundert-Standardbuch über die deutschen Hexenprozesse, Soldan-Heppe, erwähnt den Fall „Spuler“ und nennt ihn den ersten überhaupt, „der im Punkte der Hexerei dem höchsten deutschen Gericht“, dem Reichskammergericht, vorlag. Ausführlich zitiert Soldan-Heppe aus den in altertümlichem Deutsch verfassten Prozess-Akten (Nachdruck der 3. Auflage, S. S. 482 ff). – Noch ein nicht ganz abseitiger Hinweis: Der bekannte Stuttgarter/Konstanzer Historiker Arno Borst, kürzlich verstorben, erinnert an Anna Spuler in seinem mehrfach veröffentlichten Aufsatz „Anfänge des Hexenwahns in den Alpen“ (in Borst, „Barbaren, Ketzer und Artisten“, München 1988, dann in: „Ketzer, Zauberer, Hexen“ ed. Andreas Blauert, Frankfurt, 1990). Borst: Die Mutter von Anna Spulerin aus Ringingen starb 1507 „in Blaubeuren als Zauberin auf dem Scheiterhaufen; in ohnmächtiger Wut drohte die Tochter den Ringinger Nachbarn, sie sollten es noch bereuen, daß sie die Mutter umgebracht hätten. Nicht lange, und 23 Nachbarn rotteten sich zusammen, packten Anna Spulerin und schleppten sie als Hexe nach Blaubeuren ins Gefängnis. Hier erschienen Richter aus Ulm und Tübingen, verhörten und folterten sie, konnten ihr aber nichts nachweisen und mussten sie freilassen. Jetzt verklagte die gesundheitlich ruinierte Frau 1508 die Ringinger Nachbarn auf Schadenersatz, denn sie hätten gewusst und gewollt, dass sie zu Schaden komme. Der Fall ging vom Ulmer Gericht an das Reichskammergericht, von dort zu neuer Verhandlung an das Gericht der Reichsstadt Biberach; 1518 war der Prozess noch nicht entschieden.“ Soweit Arno Borst (1988, S. 262f).
Wichtigen Akten der verschiedenen Prozesse sind nicht mehr vorhanden. Nicht bestreitbar ist der Umstand, dass sich die Ringingerin gegen den Vorwurf der Hexerei mit einigem Erfolg wehrte, dass sie mit einer unvergleichlichen Tapferkeit (oder: Hartnäckigkeit?) Folterungen überstand und doch nicht von ihrem Recht, sich gegen ungerechtfertigte Beschuldigungen und deren Folgen zu wehren, ablassen wollte.
„Hexen“ in den Gender Studies
Das Thema „Hexenwesen“ und „Hexenverfolgung“ beschäftigt seit etwa dreißig Jahren in Deutschland verstärkt nicht nur Fachhistoriker, sondern auch geschichtlich und politisch interessierte „Laien“. Ein Grund ist sicher der peinliche Umstand, dass im aufgeklärten, sich als bildungsbürgerlich verstehenden Deutschland des 20. Jahrhunderts schlimmer Aberglaube grauenhafte Folgen zeitigte. So interessierten sich manche Nach-Dritt-Reich-Menschen verstärkt auch für andere Massenwahn- und insbesondere Massen-Brutalitäts-Vorgänge. Es wurden von Historikern Archive durchstöbert und brillante Überlegungen angestellt und viele Erklärungen für den Hexenwahn mit seinen Höhepunkten zwischen etwa 1500 und 1600 dargelegt und diskutiert. Eine Erklärung sei hier erwähnt, weil sie auch ein Licht auf den „Ringinger Fall“ wirft und weil sie einerseits mit Feminismus und den trendigen Gender-Studies („Welche Rolle spielt Geschlechtszugehörigkeit in der Geschichte?“) zu tun hat, weil sie sich andererseits auf Süddeutschland bezieht und von einer international anerkannten Spezialistin für Gender-Studies kommt, der angloaustralischen Historikerin Lyndal Roper. Sie hat die (vergleichsweise gut dokumentierten) Hexenprozesse in der Reichsstadt Augsburg untersucht und kommt zu dem Ergebnis, dass vor allem Frauen (nicht: Männer) andere Frauen der Hexerei beschuldigten und dass Frauen hier wahrscheinlich die (Männer-)Justiz für die Begleichung persönlicher Rechnungen einsetzten. „In den von mir untersuchten Fällen“, so Lyndal Roper, „lagen dem Vorwurf der Hexerei stets tiefe Feindschaften zwischen Frauen zugrunde, Feindschaften, die so massiv waren, dass mitunter Nachbarinnen eine Frau, die sie seit Jahren kannten, der Hexerei bezichtigten, wohl wissend, dass sie sie damit, wie eine Beschuldigte ihren Nachbarinnen entgegenschrie, als diese aus dem Haus gingen, um sie anzuzeigen, ‘in ein Blutbad‘ schickten.“ (Lyndal Roper, „Ödipus und der Teufel – Körper und Psyche in der Frühen Neuzeit“, Frankfurt 1995, S. 208).
Anmerkung vf: Lyndal Roper versteht sich als Feministin, aber – anders als viele Feministinnen – nicht als eine, die die Opferrolle von Frauen zum wiederholten Mal enthüllt und beklagt, sondern als Historikerin, die die Tatfähigkeit von Frauen darlegt. Tatfähigkeit schließt dann aber nicht nur Wohl-, sondern auch Übeltun ein. Wobei dann nicht zu vergessen ist, dass die Übeltuer hier nicht die angeblichen Hexen waren, sondern jene Frauen, die den Vorwurf erhoben.
Zum Gegenstand einer Fasnetsfigur gemacht.
Ungewöhnliche Art des Erinnerns (Einordnung von Veit Feger)
Einerseits muss man es begrüßen, dass eine tapfere Frau, die sich gegen einen großen Teil ihrer Mitbürger und indirekt gegen eine ganze Bewegung stellte, wieder in Erinnerung gebracht wird, andererseits darf man bezweifeln, ob es in der angemessenen Form geschieht. Landauf, landab gibt es an Fasnet Hexengruppen, in denen die alte Auffassung, dass Hexen böse Frauen seien, gepflegt wird; ja, es gibt sogar, wie in Unlingen, aber auch an anderen Orten unsere Raums das Fasnetsritual der Hexenverbrennung. Das heißt: das alte Unrecht wird nochmals nachgespielt, ohne Distanzierung davon. Jetzt gibt es auch in Ringingen eine Fasnetsfigur, die sich in ihrer Kleidung und in ihrer Maskenform nicht von den sonst landesüblichen Hexen unterscheidet; wer käme beim Betrachten eines Fasnetsumzugs mit einer allen anderen Figuren ähnlichen Figur auf den Gedanken, dass es sich hier um die vielleicht ungewöhnlichste deutsche Rebellin gegen Hexenverfolgung handelt?