OBERMARCHTAL / NEUFRA (vf) – Etwas Abwechslung im Programm der Sebastian-Sailer-Tage – das erhoffen sich die Verantwortlichen von einer Lesung am Sonntag, 9. September, 11 Uhr, im Spiegelsaal des Klostergebäudes. Vorgetragen wird die „Deutsche Moritat“ „Schubart-Feier“ von Werner Dürrson, Neufra. Schubart war ein schwäbischer Schriftsteller, Musiker und Regierungskritiker im 18. Jahrhundert, der für seine Kritik an der württembergischen Regierung hart büßen musste. Der Autor Dürrson machte Schubart zum Thema einer „Moritat“ und eines Theaterstücks mit Bezügen zur Gegenwart; die Texte haben eine ungewöhnliche Geschichte.
Dr. W. Dürrson erhielt für die 1977/78 verfasste, fünfzigseitige „Moritat“ 1980 den Schubart-Preis der Stadt Aalen; in jenem Jahr wurde der Text auch veröffentlicht, im Stuttgarter Windhueter-Verlag. Öffentlich vorgetragen wurde die Moritat bisher nicht, wenn man von Ausschnitten im Zusammenhang mit der genannten Preisverleihung absieht.
Moritaten werden, wie auf Jahrmärkten so üblich, von zwei bis drei Personen vorgetragen, sagt der Autor im Gespräch mit der Ehinger Schwäbischen Zeitung. Für eine Aufführung als Theaterstück sollten es mehr Schauspieler sein: Einen richtiggehenden Dramentext zum Thema „Schubart“ verfasste Dürrson vor zwanzig Jahren im Auftrag des Stuttgarter Staatstheaters. Der Text wurde vom Frankfurter Suhrkamp-Verlag (der auch ein Theater-Verlag ist) veröffentlicht. Der damals noch lebende Holzschnitt-Künstler HAP Grieshaber, mit Dürrson bekannt, fertigte für die vorgesehene Stuttgarter Inszenierung das Werbeplakat. Aber dann wurde aus der Aufführung nichts. Verschiedene Gründe spielten dabei eine Rolle.
So, wie der Moritaten-Text, war auch das Theaterstück ein „politisch‘ “ und damit für einige Obere ein „garstig“ Stück. Der vorgesehene Hauptdarsteller war mit seiner Rolle nicht einverstanden, Staatstheater-Regisseur Lukas Sutter zog nicht richtig mit. Es kam zum Eklat und zur Absetzung des Stücks vor der Uraufführung. Werner Dürrson hat einen ganzen Ordner mit Zeitungsveröffentlichungen zum Thema gesammelt. Im nächsten Jahr erscheint möglicherweise Dürrsons Selberlebensbeschreibung, in der unter anderem der Verlauf der Stuttgarter Theater-Tragikomödie nachgelesen werden kann.
Inzwischen haben sich die Zeiten geändert. Das Interesse an Politik, bedauert Dürrson, ist in Deutschland zurückgegangen. Man erinnere sich: Vor zwei Jahrzehnten bewegten Themen wie die Marinerichter-Tätigkeit des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Filbinger die Öffentlichkeit, ebenso die Nachrüstung (Stichwort „Mutlangen“); die – noch neuen – Grünen machten sich damals auf den politischen Weg. In dieser Zeit war das öffentliche Interesse auch an frühen Demokraten wie etwa Christian Friedrich Daniel Schubart größer als heute. Es war eine Zeit, in der – zum Teil im Gefolge der Studentenbewegung mehr Zeitgenossen als heute in der Geschichte nach Menschen suchten, die sich schon früher, vor der Bonner und Weimarer Republik, für Demokratie, gegen überflüssige politische Herrschaft, für die Rechte von Minderheiten etc. einsetzten – eben Spurensuche in Sachen Demokratie. Schubart ist eine der „Ikonen“ dieser speziellen Geschichte. Er wurde wegen seiner Kritik am damaligen württembergischen Herzog in dessen Auftrag von Ulm nach Blaubeuren gelockt, dort regelrecht gekidnappt und zehn Jahre auf dem Hohen Asperg inhaftiert, ohne Prozess.
Dürrson versteht sich mit seinen Schubart-Texten als politischen Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts, ist sich aber darüber klar, dass „politische Menschen“ derzeit meist nicht sonderlich gefragt sind. Geldverdienen gilt heute als eines der wichtigsten, wenn nicht als das wichtigste Ziel in unserer Gesellschaft. Andererseits freut sich Dürrson, dass sein Text nicht nur in Uni-Bibliotheken verstaubt, sondern für diese Lesung nochmals ans Licht gezogen wird.
Geboren 1932 in Schwenningen, Handwerkerlehre in Stuttgart, erste Gedichte. Ab 1953 Studium der Musik in Trossingen, mit Abschluss (später war Dürrson in Trossingen zeitweilig als Lehrer tätig), 1957 Abitur. Studium der Literaturwissenschaft in München und Tübingen, 1962 Promotion, Lehrtätigkeit an der Universität Poitiers bis 1968, anschließend freier Schriftsteller, Aufenthalt vorwiegend in Zürich, Kattenhorn am Bodensee, Stuttgart, seit einigen Jahren in Neufra bei Riedlingen.
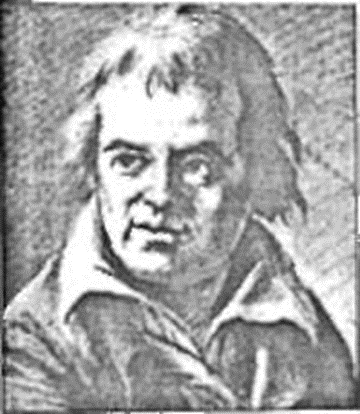
Veröffentlichungsliste: „Dreizehn Gedichte“ mit Graphiken von Klaus Staeck, Eremitenpresse 1965 (Staeck war – und ist – einer der witzigsten und boshaftesten Polit-Plakat-Entwerfer der Bundesrepublik; im ruhigen Ehingen gab es vor 25 Jahren einigen Hallas. als die damals bestehenden Jungsozialistengruppe Plakate Staecks ausstellte). ‘Flugballade“, mit Holzschnitten von HAP Grieshaber. 1966. Drei Dichtungen, 1970, „mitgegangen mitgehangen“, Gedichte. 1970 – 75. – Zahlreiche weitere Gedichtveröffentlichungen in den folgenden Jahrzehnten, zusammengefasst in vier Bänden (Lyrik und Prosa). Essays zur Literatur (Werke. Band V) 1997, Übersetzungen aus dem Französischen. Zahlreiche Literatur preise, als letzter „Eichendorff-Literaturpreis“ 2001.
Zu C F. D. Schubart
Geboren wurde Schubart 1739 in Obersontheim, aufgewachsen ist er in Aalen, gestorben 1791 in Stuttgart. Student der Theologie, Hilfslehrer und Hilfsprediger in Geislingen. Organist und Musikdirektor in Ludwigsburg, Konzertpianist, 1773 wegen regierungskritischer Äußerungen aus Württemberg ausgewiesen, Herausgeber und Redakteur verschiedener kritischer Zeitungen, von Augsburg aus. Zehn Jahre ohne Gerichtsurteil auf dem Hohen Asperg. Vier Jahre später verstorben. Verfasser auch von Gedichten und musikkritischen Schriften.
„Vorbemerkung“
Dürrsons Absicht beim Verfassen der Schubart-Moritat (1977/78) wird deutlich aus der hier vollständig widergegebenen „Vorbemerkung“. Sie dokumentiert eine heute seltene politische Einstellung.
„Diese Moritat für zwei oder drei Stimmen und möglichst viele Dreinsprecher will den Menschen Schubart zeigen und was sein Landesherr mit ihm anstellt; zum andern, was das „Kulturbewußtsein“ mithilfe eines Publikums, das großenteils an der deutschen Krankheit, dem Mangel an geistiger Auseinandersetzung, leidet, aus so einem macht.
Der Dokumentator hält sich an die Quellen; der Standort des Autors bewegt sich zwischen Schubart und dem Publikum, einzig einem Denkprozeß verpflichtet, der ihm höchst notwendig und nachholenswert erscheint.
Die Moritat ist vorführbar an jedem beliebigen Ort, auch auf Straßen und öffentlichen Plätzen, mit möglichst wenig Requisiten, zum Beispiel auch in der „Höhengaststätte Schubartstube“, von Gefangenen des Hohenaspergs. Anspielungen und Anklänge auf heutige Zustände sind, durchaus unzufällig. Werner Dürrson“
► Nachgefragt
Im Blick auf die „Urlesung“ eines Textes von Dr. Werner Dürrson, Neufra, im September in Obermarchtal stellte Veit Feger, Ehingen, einige Fragen an den Autor:
SZ: Warum leben Sie ausgerechnet in dem kleinen Neufra?
Dürrson: Dort ist’s nicht so idyllisch wie am Bodensee. Am See war‘s mir fast zu schon. Das Klima in Neufra bekommt mir auch gut. Und dann kann ich endlich in einem Schloss wohnen.“ (Zur Erläuterung sei angefügt, dass dieses Schloss vor allem durch seine landschaftliche Lage hoch überm Donautal beachtlich ist).
SZ: Gibt es eine wichtige Person für die Entwicklung des Schriftstellers Dürrson?
Dürrson: Hermann Hesse. Ich durfte neun Jahre mit ihm Briefe wechseln und ihn dreimal besuchen. Er gab mir wichtige Hinweise für die Tätigkeit als Schriftsteller.
► Ansicht
Der Marchtaler Pater Sebastian Sailer ließ zwar Gottvater als schwäbischen Großbauer (oder: einen schwäbischen Großbauer als Gottvater) auftreten, er war aber, wie sich an anderen Texten aus seiner Feder zeigt, von Grund auf obrigkeitlich gesinnt und Gegner der Aufklärung.
Der Autor Werner Dürrson, der Sailer-Tage-Veranstalter Wolfgang Schukraft aus Ulm und Mit-Leser Walter Frei aus Ehingen erhoffen sich von der Erinnerung an C. F. D. Schubart in Form einer öffentlichen Lesung, dass die Sailer-Tage ein wenig politischer werden und weniger 18.-Jahrhundert-Kloster-Romantik-verliebt. Leicht ist die Verwirklichung einer solchen Absicht nicht, schließlich wird Dürrsons „Moritat“ im Repräsentationsraum des einstigen Klosters, dem feudalen Spiegelsaal, vorgetragen. Und das Publikum wird ein bildungsbürgerliches sein. Wer interessiert sich sonst schon für einen Schriftsteller des 18. Jahrhunderts? Mit diesem Satz soll nichts gegen das Bildungsbürgertum gesagt sein, auch der Verfasser dieser Zeilen zählt dazu, Aber übermäßig viele sind das nicht.