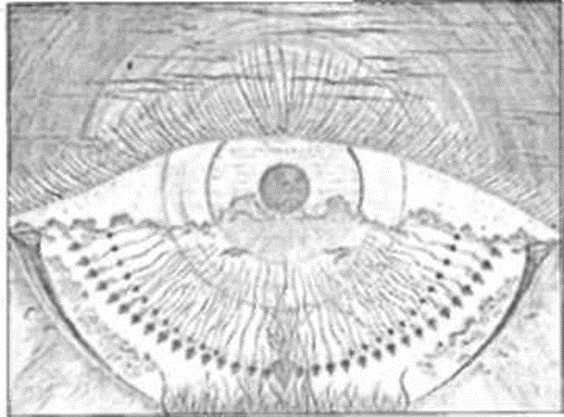ALTHEIM / EHINGEN (vf) 1960 wurde die Kirche des Orts renoviert; an diesem März-Wochenende 2003 wird der Abschluss einer weiteren Renovierung gefeiert. Zur Renovierung 1960 (!) verfasste Dr. Tiberius Denkinger einen Aufsatz zur Geschichte der Dorfkirche seiner Heimat, der in der Ehinger SZ und auch als Sonderdruck „aus Anlass der Kirchenrenovation“ erschien. T. Denkinger (1886 – 1979) war katholischer Geistlicher und Lehrer am Riedlinger Gymnasium; als Ruheständler hat er eine höchst gelehrte Heimatgeschichte verfasst, unter dem Titel „Herren, Höfe, Häuser und Fluren in Altheim, Kreis Ehingen“; sie erschien 1963 In einer Auflage von 300 Stück und 1982 als Nachdruck, erweitert um einen Lebenslauf des Verfassers, der übrigens die Erstveröffentlichung selbst finanziert hatte und den seine Heimatgemeinde zum Ehrenbürger ernannte. – Im Buch wird der Schwerpunkt auf die bäuerliche Geschichte des Dorfs, seiner Häuser, Höfe und Familien gelegt. So war ein eigener Aufsatz über die Kirche des Orts ein mögliches Thema. – Den Aufsatz von 1960 drucken wir hier (mit geringfügigen Redigierungen und mit einigen Erläuterungen plus Zwischenüberschriften) nach.
In Altheim ist man daran, die Kirche zu renovieren. Sie ist ein typisches Beispiel für den Stil und die Art, wie man gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine Dorfhallenkirche gestaltete. Sie steht deshalb unter staatlichem Denkmalschutz.
Ehrenamtliche Arbeit auch anno 60
Zunächst hat man ihr Mauerwerk auf der Nord- und Ostseite trocken zu legen versucht. Die hierfür nötigen umfangreichen Grabarbeiten wurden anerkennenswerter Weise in Gemeinschaftsarbeit Altheimer Bürger ausgeführt.
Die Vorgängerkirche war marode
Diese Altheimer Kirche steht bald 175 Jahre. Am 2. Juni 1785 wurde die alte Kirche bis auf den Grund niederzureißen begonnen Zunächst hatte man nur ein neues Dach auf die alten Mauern setzen wollen, was auch vom Bischof von Konstanz, dem unsere Gegend damals unterstand, genehmigt war. Aber bei näherem Zuschauen zeigte es sich, dass es das Richtige war, die Kirche gänzlich niederzureißen und neu zu bauen, was man auch unverzüglich tat. Als der Bischof davon verständigt wurde, waren die neuen Mauern schon halb hoch gediehen: was blieb ihm anders übrig, als den Neubau zu genehmigen. Die Baukosten, die im Voranschlag des Erbauers, Architekt Michael Wenger von Mietingen, 3372 fl. betragen sollten, beliefen sich endgültig auf 3500 fl. Geweiht wurde die Kirche am 10. August 1786, der Hochaltar zu Ehren des Erzengel Michael, der Nebenaltar auf der Evangelienseite der Muttergottes und hl. Anna, der auf der Epistel-Seite (vf: die Seite des Schiffs, auf der aus dem Evangelium vorgelesen wird) zu Ehren des hl. Sebastian und hl. Franz Xaver, deren Bilder bisher die Altäre zierten.
Schon 1275 gab es einen Pfarrer
Wir wollen uns aber nun der Vorgängerin dieser Kirche zuwenden. Wir kennen nur eine dieser Vorgängerinnen, eben die 1785 niedergerissene. Sie dürfte 300 Jahre alt gewesen sein, als sie niedergerissen wurde. War dies die erste gewesen, die in Altheim Stand? Sicher nicht! Schon 200 Jahre früher, 1275, gab es einen Pfarrer in Altheim, also auch eine Pfarrkirche. Das ist aber nur der erste Pfarrer, von dem wir eine Nachricht haben. {Vgl. T. Denkinger. Zur älteren Geschichte der Pfarrei Altheim in „Ulm und Oberschwaben“ Bd. 34 {19S5) S. 193 ff.).
Da der Kirchenpatron Michael heißt, der für in alemannischer Zeit gegründete Kirchen zuständig ist, muss die erste Kirche schon früh, sagen wir im 7. Jahrhundert, entstanden sein. Dass diese Michaelskirche ein Filial (vf: eine Nebenkirche) gewesen sein soll zu der dem hl. Martin, einem Franken-Heiligen und Franken-Patron geweihten Erbacher Kirche, muss unwahrscheinlich erscheinen, wenn auch eine 300-jährige Tradition und die Tatsache dafür zu sprechen scheinen, dass der Altheimer Kleinzehnt aus der Altheimer Markung, so lange Zehnt überhaupt gegeben wurde, der Erbacher Kirche zustand. Ob in der Zeit von etwa dem siebten bis zum bis 15. Jahrhundert nur eine Kirche, oder, was wahrscheinlicher ist, mehrere Kirchengebäude nacheinander in Altheim standen, lässt sich heute nicht mehr sagen.
Der jetzige Turm ist wesentlich älter als die jetzige Kirche
Wie aber wissen wir, wann die Vorgängerin unserer heutigen Kirche gebaut worden ist? Wir wissen, dass man 1785 den Turm nicht abgerissen hat, und wir sehen an seiner Form, dass dieser Turm spätgotische Züge zeigt, dass er also im 15. oder 16. Jahrhundert erbaut sein muss. Wenn wir näherhin behaupten, dass er gegen Ende des 15. Jahrhunderts, oder genauer um 1485 erbaut worden ist, so kommt das daher, dass sich in der abgerissenen Kirche eine Inschrift befand, welche die Jahreszahl 1485 aufwies, die von einem Obervogt des 17. Jahrhunderts zu Gunsten seines Herrn dahin gedeutet wurde, damals sei unsere Kirche aus dem Filialverhältnis gelöst worden durch den Vorgänger seines gnädigen Herrn. Da aber anzunehmen ist, dass der Turm und die Kirche ungefähr zu gleicher Zeit gebaut wurden, andererseits das Jahr1485 zur spätgotischen Zeit gerechnet werden muss, so liegt es nahe, dass Turm und Kirche um 1485 erbaut worden sind.
Über die ersten Jahrzehnte dieser 1485 erbauten Kirche wissen wir nichts. Es musste erst die schreckliche Zeit des 30-jährigen Krieges kommen, um die Gemeinde zu veranlassen, etwas über ihren Zustand niederzuschreiben.
Zwei Jahre lang war keine Taufe mehr in der Kirche, im großen Krieg
Was hätte diese Küche alles erzählen können von menschlichem Leid und Jammer, als 1635 von den etwa 250 Einwohnern innerhalb eines halben Jahres 130 Menschen an Hunger und Pest dahinstarben Wie musste die Kirche verlassen dastehen, als vom 17. Oktober 1646 bis 5. Oktober 1647 sämtliche Taufen in Ehingen gespendet wurden, wo die ganze Gemeinde Zuflucht gesucht hatte vor den plündernden Franzosen, Kaiserlichen und Schweden.
Letztere scheinen ein so schreckliches Andenken hinterlassen zu haben, dass in den Kirchenrechnungen, wenn auf diesen Krieg später (noch 1700) die Rede kommt, er immer nur der „Schwedenkrieg“ heißt. Dass es dabei auch dem Kirchengebäude selbst übel erging, zeigen die Berichte um 1650, als nach Durchführung des Westfälischen Friedens (1648) und der Rückkehr der Geflohenen und der Eingewöhnung der aus Bayern, Österreich und der Schweiz neu Zugezogenen ein neues kirchliches Gemeindeleben wieder begann. 1647, am 6. Oktober, werden zwei Kelche verkauft, offenbar, um das nötigste Geld für den Gottesdienst zu bekommen. Dann musste zunächst ein Mann zwei Tage lang die Kirche „räumen“. Er bekommt dafür 16 Kreuzer. In Kirche und Pfarrhof müssen zudem Scheiben eingesetzt werden. So werden am 25. November 1650 dem Glaser von Ehingen 20 fl. (vf: florin, Florentiner, Gulden) 36 Kr. bezahlt, „dass er alle Fenster in der Pfarrkirche Altheim von neuem Glass gemacht hat“.
1651 zählen noch 60 Seelen zur Kirchengemeinde
Ein Visitationsbericht (vf: Kontrolle der Seelsorgearbeit) des Bistums Konstanz berichtet um 1651: Ulrich Edel von Munderkingen ist Pfarrer, 50 Jahre alt. Er hat 60 Pfarrgenossen, der Pfarrhof ist „ruinosa“, vor dem Allerheiligsten kein lieht, de» Friedhof von Sträuchern und Baumen bestanden. Kirchen Einkünfte gänzlich erstorben.
Ehinger Handwerker kriegen Arbeit
Im Oktober 1651 werden dem Maurer von Ehingen wegen der Kirchenmauer 8 fl. bezahlt. Dem Uhrenmacher Jerg Bidermann zu Ehingen (Vgl. Weber, Stadtgeschichte Ehingen, S. 359) 1 fl. 30 Kreuzer, „weil er das Uhrenwerk wiederum hat zugerichtet“. Dem Schmied 12 kr. „dass er die Gloggenklengel gemacht hat“. Dem Sattler in Ehingen für einen ledernen .Riemen zu der großen Gloggen 26 Kreuzer. Am 16. Febr. 1651 für einen neuen Weihwedel 10 kr., Baumöl für die Kirchenuhr 2 kr. Für ein großes Glockenseil 1 fl.
Kirchenbücher und Glockenriemen werden wieder angeschafft
Die Herrschaft (vf: der Ortsadelige) hat ein neues Missale (Meßbuch) von Konstanz kommen lassen, dazu werden „7 Ellen feielblauseidene Bändel zu einem Register“ gekauft um 10 kr. Es wird ein neues Benedictionale {Buch der Segnungen) für die Kirche gekauft um 1 fl. 40 kr. Anno 54 braucht man schon wieder neue Glockenseile und zahlt außerdem dem Hensinger zu Ehingen für einen Glockenriemen. Den er vor 20 Jahren hergegeben für die Kirch. Für ein der Kirchenpflege gehöriges Kalb („Heiligenkalb“) erlösten die Kirchenpfleger in Ulm 3 fl. 12 kr.
Ein Caravaca-Kreuz auf dem Dach
Es ist vielleicht schon manchem Besucher der Kirche aufgefallen, dass die Altheimer Kirche ein eisernes Kreuz mit Doppelbalken oben auf dem Dach trägt Es ist ein sogenanntes Caravaca-Kreuz, benannt nach der Stadt Caravaca in Spanien, wobei nach der Legende ein solches Kreuz von Engeln gebracht worden sein soll. Es wurde im 16. und 17. Jh. besonders verehrt als Wetterkreuz. Vielleicht durfte es hier nach den Erfahrungen von 1635 auch vor der Pest schützen, wie das Abbrennen der Sebastianuskerze, die schon 1647 erwähnt ist: „Für St. Sebastianskerze zu machen 5 Kreuzer.“
Das Kreuz scheint damals schon auf der Kirche gewesen zu sein, da es 1657 heißt: .Item dem Schmied geben 17 kr., dass er das Spanische Kreuz auf der Kirchen wiederum zugerichtet hat.“ Das scheint aber nicht zu lange gehalten zu haben. Denn 1690 gibt man dem Schlosser von Ehingen 3 fl. 30 kr. um ein (neues) eisernes Spanisches Kreuz auf die Kirchen“. So wird auch immer wieder die Sebastianuskerze als Ausgabeposten in der Kirchenrechnung aufgeführt.
Diebstahl Sicherung früher
Zweimal ist von einem Kircheneinbruch berichtet 1662 werden dem Schlosser von Hütten 52 Kreuzer bezahlt, „darum dass er zwo eißen überzwerch Stangen mit Zwingen für die Fenster gemacht hat, da man bei Nacht an demselben Orth in die Kirchen gebrochen“. Sodann wieder 1697: „Dem Glaser für das Fenster, so bei dem Einbruch in die Kirche verderbt: 3 fl. 20 kr.“
Ortsadel als Spender
In den schweren Tagen der Wiedereinrichtung der Kirche kamen dem Gotteshaus Zuschüsse von Gliedern des herrschaftlich Freybergischen Hauses. So vermachte Frau Ursula von Ulm, geb. Freiin von Freyberg, .dem hl. Michael“, also der Altheimer Kirchenpflege, 100 fl. (3. Februar 1660); ebensoviel am 29. Juli 1663 Elisabeth Barbara, Freifrau von Freyberg, geb. Löschin von Hilkertshausen. Dazu kam ein Legat (vf’ Stiftung) des am 26. Juni 1664 zu Dillingen verstorbenen, aber in Altheim begrabenen Ortsherrn Albrecht Ernst von Freyberg in der Höhe von 150 fl. die für die Renovation der „Pfarrkirche von Altheim bestimmt waren, „wie das in dem Jahr anno 1665 geschehen ist.
Ziegel aus Dächingen, Bretter aus der Ehinger Sägmühle
Für die Renovierung brauchte man „zwei eichene Dillen aus der Sägmühle zu Ehingen. Ziegelsteine. 200 von Ulm, 800 von Dächingen, letztere zum Preis von 6 fl. 45 kr., Kalk von Steinenfeld, die Bretter von Ulm, den Schlosser von Hütten, von Steißlingen den Kapellenschneider,“ denn auch die kirchlichen Gewänder wurden restauriert: ein „damastisch blaues“ und ein schwarzes Meßgewand mußte der Kapellenschneider“ „auf die römisch Manier“ zurichten.
Fürstbischof als Stifter
Die massive innere Kircheneinrichtung erfolgte etwas später, ab 1672 eine Stiftung des Fürstbischofs zu Augsburg Johann Christoph von Freyberg (geb. zu Altheim 13. 9. 1616) eingetroffen war in Höhe von 300 fl. zu einem Familienjahrtag mit monatlicher Messe und Almosenaufteilung an Arme. Nun erscheinen in der Kirchenrechnung Posten für die Innenausstattung: Ein Büchele im Wald gehauen und als Saul (vf: Säule) an die Borkirch gemacht – „Item einem Schreiner von Ehingen. Meister Barthollome N., für das Kirchengestühl der Männer und Weiber und Borkirchen „geben worden 18 fl.“ – Dem Mahler zu Ehingen für Krucifix und Altäre zu renovieren 18 fl.. Caspar Fiats und Hans Schaiblin die zwen Altar von Dillingen zu holen 8 fl. – Im November 1674 hörte man den Choraltar in Ulm ab, den der „Herr Maler von Dilligen begleitete.
Kirche – das bedeutet: renovieren
Um 1677 bekommt der Schreiner für den Beichtstuhl 5 fl. 15 kr. .Item (vf: ebenso) dem Bildschnitzer (wohl von Ehingen, da die Figur in Ehingen abgeholt wird) für Sankt Michaels Bild samt aller Zubehör m schnitzen 9 fl., Engelsgeschöpf auszubessern 42 kr. Item dem Maler, um S. Michaels Bild fassen zu lassen und 4 Engelsköpf zu erneuern 16 fl. 30 kr.
Auch für die Altarwäsche wird mit der Zeit gegangen: Um 1680 liefert H. Kaiblin in Ehingen 4 Kelchtüchlein von Taffet (Taft) in viererlei Farben um 5 fl. 20 kr.. Gleichzeitig wird Kirchen- und Turmdach auf einer Seite mit Platten belegt um 22 fl.
Ein Kelch, aus Talem gefertigt
Oben erwähnter Meister Barthollome verändert den Tabernakel; für 9 lateinische Täfelein auf die 3 Altäre, so zur hl. Messe gehören (Kanontafeln) 36 kr. – Von Bartholome Weiss bezieht man eine Fahne um 15 fl. Um 1692 schafft Thomas Gasser, Maurer von Allmendingen, an Kirchendach, Ringmauer und Vorzeichen 37 Tage lang zu einem Taglohn von 28 Kreuzer. Auch einen neuen Kelch und eine neue Patene (vf: Hostienteller) soll der Goldschmied in Ehingen verfertigen aus 27 „ihm übergebenen halben Thalergoldstücken im Wert von 20 fl., 15 kr. – Der neue Kelch wird dann nach der Prämonstratenser-Abtei Roggenburg in Schwaben gesandt, wo er, von selbigem Prälaten“ geweiht werden so
Der Goldschmied wird im örtlichen Wirtshaus verköstigt Als der 1710 ernannte Pfarrer Simon Weiß in seiner Pfarrei eingewöhnt war, ließ er 1715 um 24 fl. bei einem Goldschmied in Gmünd beide Kelche, die Monstranz und das Ciborium „aufbuzen und renovieren“; der Goldschmied führte diese Arbeit rh Altheim aus, denn die Kirchengemeinde zahlt für ihn an den Wirt Kostgeld. Als 1717 ein neuer Pfarrer kam, fand er, dass ein „gar schlechter silberner Kelch unbrauchbar sei“, so ist (1718) „solcher zusammengeschlagen an Herrn, Johann Sebastian Mylius……