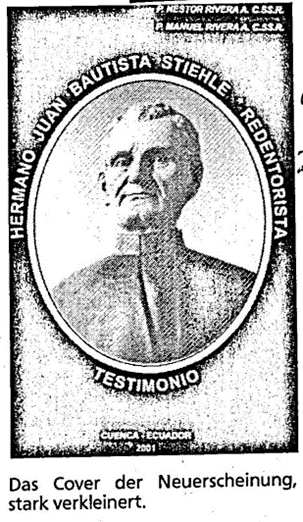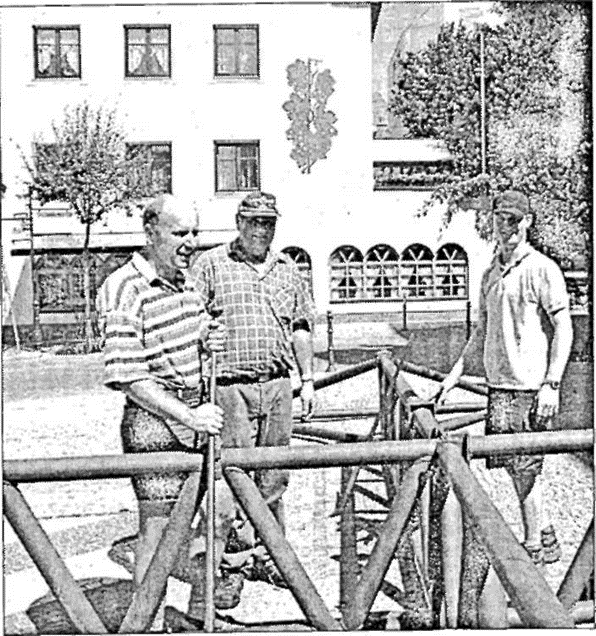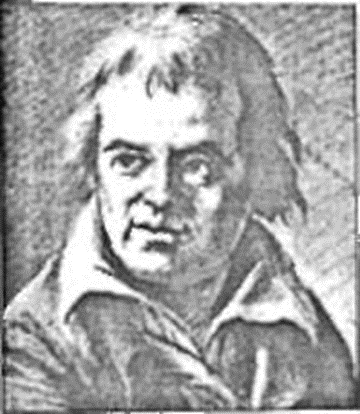LICHTENSTEIN / ERSINGEN (vf) – Von 1978 bis 86 war Fritz Streitberger Pfarrer in Ersingen (und als solcher auch zuständig für die Protestanten von Öpfingen, Oberdischingen und Rißtissen). Dann trat er in den Ruhestand und wohnt mit seiner Frau seit 1990 in Unterhausen unterhalb von Burg Lichtenstein, in der Nähe seiner Heimatstadt Reutlingen. Als Senior ist Streitberger unter die Autoren gegangen und hat eine Lebensbeschreibung von Christian Friedrich Daniel Schubart (1739 -1791) und drei Gedichtbände verfasst und veröffentlicht. Autor Fritz Streitberger, früher Ersingen
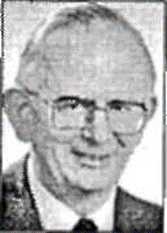
Das Autorenleben begann Streitiger eher mit Gedichten: vorwiegend für Familienfeste (Taufen, Hochzeiten, Konfirmationen etc.) verfasste er Balladen zu biblischen Geschichten. Weil zwei Enkel auf die Vornamen Jonas beziehungsweise Judith getauft wurden, dichtete Streitberger für die Tauffeiern humorvolle Verse zu diesen alttestamentarischen Geschichten vom Prophet Jona und von der tapferen Frau Judith.
Bild: Autor Fritz Streitberger, früher Ersingen
Im Lauf der Jahre kamen mehrere Balladen über verschiedene Gestalten des Alten Testaments zusammen, auch „Daniel“ taucht auf. Inzwischen sind dem ersten Bändchen im Berliner Frieling-Verlag zwei weitere gefolgt.
Der erste Band, aus dem Jahr 1998, liegt seit kurzem bereits in zweiter Auflage vor.
Die Titel der drei Bändchen deuten die heitere Stimmung der Verse an: „Und alle Löwen waren friedlich“, „Er war kein Freund von halben Sachen“ und „Zwei Eselinnen sind entlaufen“. Die zwei letzteren Balladenbüchlein sind erst in diesem Jahr erschienen und wurden illustriert von einem Schwiegersohn des Ehepaars Streitberger, von dem Neu-Ulmer Zeichenlehrer Wolfgang Neidlinger.
Aber wie kommt ein lutherischer Pfarrer auf .einen rebellischen Schriftsteller des 18. Jahrhunderts, C. D. F. Schubart, den politisch widerständigsten Mann der württembergischen Geschichte seiner Zeit? Nun, einfach, und Streitberger bekennt das auch im Vorwort zu der im April 2001 erschienenen Lebensbeschreibung: Er selbst stammt mütterlicherseits von Johann Konrad Schubart, einem Bruder des Schriftstellers, ab. Der Aalener Stadtschreiber J. K. (1743-1808) hat seinen Bruder immer wieder unterstützt; dieser selbst hatte keine heute noch lebenden Nachkommen.
Streitberger begründet seine Autorenschaft bescheiden damit, dass es derzeit auf dem Markt keine leicht lesbare Biographie Schubarts gebe. Er begründet sie auch damit, dass die religiöse Seite Schubarts bisher von Biographen nicht sonderlich behandelt worden sei. Ihm als Pfarrer liege das halt nahe. Streitberger nennt im Gespräch mit der Ehinger SZ-Redaktion als gute Biographien Schubarts eine von dem Musikhistoriker Kurt Honolka, die habe aber vor allem
den Musiker und Musikwissenschaftler Schubart zum Gegenstand, dann eine Schubart-Biographie aus der Feder des Schriftstellers Peter Härtung, die sich vor allem auf den Dichter Schubart richte, jetzt, mit Streitberger, eine Lebensbeschreibung, die auch die religiöse Entwicklung Schubarts behandelt. Diese Akzentsetzung ist nicht selbstverständlich, weil Leute, die sich heutigen Tags an Schubart erinnern, das aus anderen Gründen tun, vor allem aus politik, demokratie- und zeitungsgeschichtlichen Interessen. Der 130 Seiten lange Text ist im Frühjahr im Salzer-Verlag Bietigheim erschienen, in einer Auflage von 2000 Stück. Sechs- bis siebenhundert Exemplare sind in den Monaten seither verkauft worden. – Einerseits freut sich der Verfasser, dass sein Buch erschienen ist, andererseits hat ihm die Bietigheimer Verlegerin (und zugleich Lektorin) seinen maschinengeschriebenen Text kräftig gekürzt, mit der Begründung, eine bestimmte Länge dürfe das Bändchen nicht überschreiten, weil der Ladenpreis sonst dreißig Mark überschreite und das Buch sich dann schlecht verkaufe. Also: Runter mit den Zeilen, runter mit den Seiten! Was bleibt dem Autor anderes übrig als das zu schlucken, so wie manche Zeitungsschreiber die Kürzung ihrer Texte leiden müssen und sich trösten mit dem Satz: „Lieber kurz und drin als lang und nicht drin.“

Die lustige Geschichte vom Prophet Jona
Im folgenden eine Textprobe aus Streitbergers Buch mit Biblischen Balladen: „Und alle Löwen waren friedlich“, 2. Auflage, Berlin 2001, „Kapitel“ Jona: „Assyrien war ein großes Land und seine Hauptstadt weltbekannt. Sie war auch äußerlich „okay“ und hieß mit Namen: Ninive. Man konnte ehrfurchtsvoll erschauern beim Anblick ihrer dicken Mauern. Es gab auch Türme, stolz erhaben, und einen tiefen Wassergraben. Und wollte man die Stadt durchwandern von einem Ende bis zum andern, dann brauchte, das stand außer Frage, zu Fuß man mindestens drei Tage. Es schwärmten von dem Häusermeer und Stadtbild die Touristen sehr. Bei Sonne riefen sie und Schnee: „Wie prächtig ist doch Ninive!“ Gott aber sah es voller Grimm: Im Übrigen war sie sehr schlimm. Er sah von seinem hohen Stuhl: Sie war ein arger Sündenpfuhl. Beständig und zu eignem Schaden die Niniviten Böses taten: – Vom Guten sie nicht einmal träumten, die Nächstenliebe sie versäumten, ergaben sich dem Saufen, Fressen, die Armen haben sie vergessen, oft haben schamlos sie gelogen und gegenseitig sich betrogen, von Kulturellem und von Kunst, da hatte kaum man einen Dunst. Es gab, in vielerlei Gestalt, Pornos und Drogen und Gewalt. Der Gipfel war: Verruchte Hände beschmierten öffentliche Wände mit unverschämten Hass Parolen: „Die Fremden soll der Teufel holen!“ Doch Gott sah aus von seiner Höh’ und übersah nicht Ninive. Nachdem dies Elend er gesehn, sprach er: „So kann’s nicht weitergehn!“ Er spähte aus im ganzen Land per Fernglas, bis er Jona fand. Und diesem ausgesuchten Mann gebot er: „Zieh dir Schuhe an und Anorak und Hut und geh, so schnell du kannst, nach Ninive und dort verkünde d:eser Stadt, die meiner ganz vergessen hat: „Ihr Leute, ihr müsst alle hören, bald muss ich Ninive zerstören!“