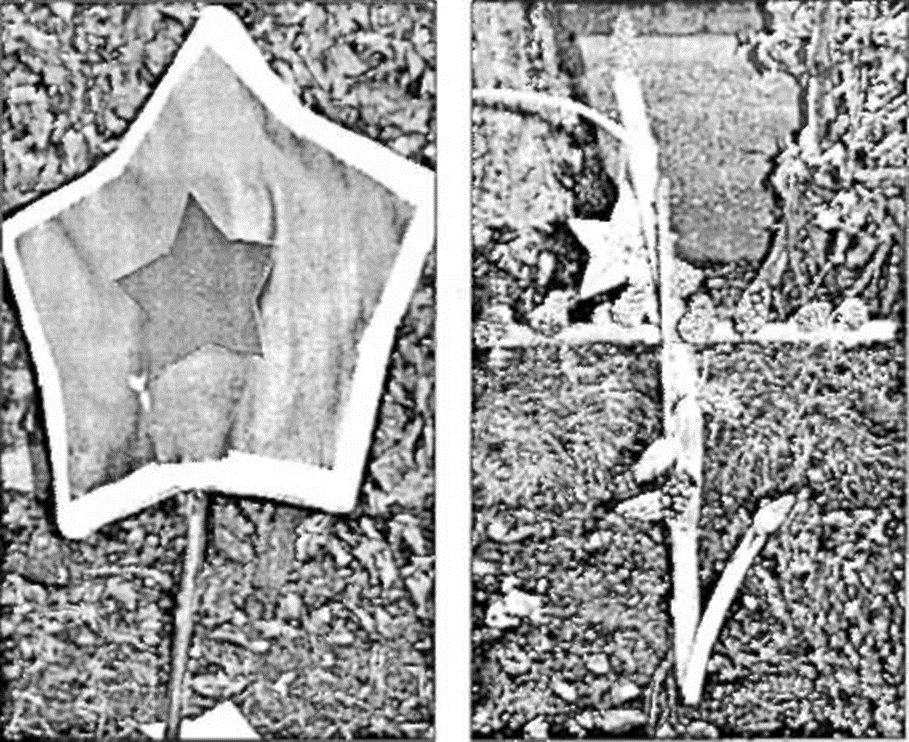GÖTTINGEN / EHINGEN (vf) – Die 1953 in Ehingen geborene Traudel Weber-Reich hat kürzlich in Göttingen eine Doktorarbeit aus dem Bereich der Sozialgeschichte abgeschlossen und an der Berliner Humboldt-Universität eingereicht. Nach den zugehörigen Prüfungen wird sie eine der ersten Frauen in Deutschland sein, die den Titel „Dr. rer. cur.“ tragen darf, Doktorin der Pflege Wissenschaften. Die ausgebildete Krankenschwester ist bereits mit mehreren Veröffentlichungen frauen- und krankenhausgeschichtlicher Art hervorgetreten.
Vor einigen Jahren erwarb der Verfasser dieser Zeilen antiquarisch das 1993 erschienene Buch „Des Kennenlernens werth – Bedeutende Frauen Göttingens“, 370 Seiten, erschienen im Göttinger Wallstein-Verlag. Interesse an Frauengeschichte und allgemein an Kultur- und Wissenschaftsgeschichte hatten vf das Buch kaufen lassen.
Herausgegeben war das Buch von einer dem vf nicht näher bekannten Traudel Weber-Reich. Jahre später bekommt der Buchkäufer mit, dass die Herausgeberin des Gesamtbandes und Verfasserin einiger in dem Sammelband enthaltener Aufsätze aus Ehingen stammt – Anlass für eine Nachfrage. Der Tochter aus einer Ehinger Handwerkerfamilie war es nicht, wie man so sagt, an der Wiege gesungen worden, eines Tages wissenschaftlich, vor allem im Bereich der weiblichen Berufsgeschichte, zu forschen. Ein Stück Frauenemanzipation sieht die Autorin sicher auch in ihrer eigenen Lebensgeschichte.
Traudel Weber aus der Ehinger Weitzmannstraße, geboren 1953, besuchte in Ehingen etc. Grundschule und sechs Jahre das Gymnasium. Dann lernte sie am Paracelsus-Krankenhaus in Ruit/Ostfildern ihren Beruf.
Zum Thema Pflege verfügte das Stadtarchiv Göttingen über einen umfangreichen, aber ungeordneten und nicht ausgewerteten Aktenberg. Diesen Berg sortierte und wertete die Studentin für ihre Magisterarbeit aus. In Buchform erschien diese Arbeit 1993 bei Vandenhoeck & Ruprecht unter dem Titel „Um die Lage der hiesigen notleidenden Gasse zu verbessern. Der Frauenverein zu Göttingen“ – Ein wenig missionarische Haltung schwang bei dieser Arbeit schon mit. Frauen, so die Autorin im Gespräch mit der Ehinger SZ, haben eine eigene Geschichte, eine andere als die Männer, eine Geschichte, die sie formt, bis heute, eine Geschichte, die die Frauen daher kennen sollten. Frauen haben aber Geschichte nicht nur erlitten, sondern auch gestaltet. Traudel Weber-Reich lieferte für ihren Lebensraum Göttingen einige Beweise für diese Behauptung – auf zwei Feldern geschichtlicher Forschung. Mit ihrer Untersuchung der Geschichte des Göttinger Frauenvereins hatte sich Weber-Reich für stadtgeschichtliche Arbeit qualifiziert. Sie erhielt von der Stadtverwaltung eine befristete Stelle, in der sie Regionalgeschichte weiterhin unter „Frauen“-Aspekt aufarbeiten konnte. Beachtliche Frucht dieser Arbeit: die Herausgabe eine Reihe Lebensläufe bemerkenswerter Frauen, die mit Göttingen zu tun haben, die dort geboren wurden oder dort lebten.
T. Weber-Reich steuerte zu dem Sammelband mit über vierzig Lebensbeschreibungen einen Sammelbeitrag über jene sechs Frauen bei, die den „Frauenverein zu Göttingen“ in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gründeten, außerdem einen Aufsatz über Elise Bürger geborene Hahn (1769 – 1833), die Ehefrau des Schriftstellers Gottfried August Bürger, Schauspielerin und Schriftstellerin und mit G. A. Bürger in einer zu ihrer Zeit bekannt gewordenen Ehegeschichte verknüpft.
Traudel Weber-Reich sah sich vor keine leichte Aufgabe gestellt, als sie für die Biographien der sehr verschiedenen „Göttinger“ Frauen fähige Autorinnen gewinnen musste. Sie hatte das – zum Teil unangenehme – Geschäft, auswählen zu müssen, immerhin konnte T. Weber-Reich überregional anerkannte Autorinnen gewinnen, etwa Sigrid Damm (mit einer Biographie der Romantik-Muse Caroline Schelling, 1763 • 1809) bekannt geworden, oder Andrea Hahn (mit einem Aufsatz über die Schriftstellerin und erste deutsche Zeitschriften-Redakteurin Therese Huber geborene Heyne. 1764 – 1829). oder die Autorin Cordula Tollmien (mit einem Aufsatz über Minna Specht, 1870 – 1961).
Die genannten Zuarbeiterinnen und zahlreiche weitere Autorinnen mussten alle auf eine gewisse Länge oder Kürze und Qualität der Texte „eingeschworen“ werden.
Bild: Deckblatt (Ausschnitt) eines Buchs, das T. Weber-Reich herausgegeben und zu dem sie auch einiges beigesteuert hat.
Weil Göttingen eine Uni-Stadt – mit einigen recht aufgeschlossenen Professoren – war, kam es schon vor längerem dazu, dass hier Frauen (als Professoren-Töchter) aufwuchsen, die es dann selber in Sachen produktive Bildung wert brachten; Und es gab andere Frauen, die hier studierten, arbeiteten und (im letzten Jahrhundert erstmals auch) lehrten, alles Frauen, die „des Erinnerns werth“ sind. Zu den bekannteren und in Traudel Weber-Reichs Buch vertretenen gehören die Verlegerin Anne Vandenhoeck (1709 – 1787), die intellektuelle und emotionale Inspiratorin romantischer Schriftsteller und Philosophen Caroline Schelling, die Schriftstellerin Therese Huber, die Schriftstellerin und Psychoanalytikerin Lou Andreas-Salome, die Mathematikerin Emmy Noether, die Schulreformerin Minna Specht, die
Philosophin und Ordensfrau Edith Stein, die Historikerin Elisabeth Heimpel.
Bevor das Buch erschien und zunächst auch danach hatte die Herausgeberin und Co-Autorin einen ziemlichen Bammel: Göttingen ist Universitätsstadt, es gibt genügend Leute, die mit Büchern zu tun haben; die literarischen Ansprüche sind hoch. Da war Traudels Freude groß, als die Veröffentlichung gute Kritiken bekam und die erste 1500-Stück-Auflage schon nach sieben Wochen ausverkauft war. Inzwischen liegt das Buch in dritter Auflage vor.
Das Interesse an Frauengeschichte und an der Geschichte ihres eigenen ursprünglichen Berufs als Krankenschwester konnte Weber-Reich in den folgenden Jahren verknüpfen. Sie sah, dass zahlreiche Krankenhausgründungen vor allem im 19. Jahrhundert von Frauenvereinigungen, insbesondere religiös orientierten, ausgingen. Vier wichtige Krankenhäuser in Göttingen sind Gründungen von Frauen. Mit die ersten dieser Gründerinnen, im protestantischen
Göttingen, waren katholische Ordensfrauen, Vinzentinerinnen mit Mutterhaus in Hildesheim. Zum hundertjährigen Bestehen des von ihnen gegründeten und getragenen Krankenhauses verfasste Weber-Reich im Jubiläumsjahr 1996 einen Beitrag.
Neben der Vinzentinerinnen-Gründung gab es in der Stadt auch Krankenhaus-Gründungen durch Diakonissen und die Klementinen-Krankenhausschwestern. Dass Frauen hier die entscheidende Rolle spielten, dass sie die Arzte anstellten und das finanzielle Risiko trugen, das wurde später oft wenig beachtet (es wurde auch von den bescheidenen Frauen nie plakativ betont). Traudel Weber-Reich legte diese Gründungsgeschichten für Göttingen ausführlich dar.
Einen etwas anderen Aspekt des Frauenlebens als den zölibatären der pflegenden Ordensfrauen und Diakonissen behandelte Weber-Reich in einem 1997 erschienenen Aufsatz über „Frauen in Not – Alltagsleben und Geburtenpolitik1919-I933“.
Die Doktorarbeit, die Weber-Reich kürzlich abschloss, wurde von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert; die Stiftung vergab fünfzig Stipendien, zur Erforschung (vorwiegend weiblicher) Pflege-Tätigkeit. An der Humboldt-Universität Berlin wurde ein eigener Studiengang für Forschungsarbeiten im Bereich Pflege eingerichtet, der mit dem Titel „Dr. rer. cur.“ abgeschlossen werden kann. Vor einem dreiviertel Jahr wurde der Titel erstmals verliehen. Veit Feger
► Nachgefragt
Der persönliche Gewinn geistiger Arbeit (Die Fragen stellte Veit Feger)
SZ: Frau Weber-Reich, hat Ihre wissenschaftliche Arbeit Ihnen auch persönlich einen Gewinn eingebracht?
Weber Reich: Ich wurde gebeten, Vorträge auf Fachtagungen und vor interessierten Frauenvereinigungen zu halten. Das war eine neue Aufgabe für mich. Man gewinnt dadurch mehr Sicherheit im Auftreten. – Dadurch, dass ich mich mit der Geschichte der Frauen in früherer Zeit befasst habe, wurde mir auch deutlich, wie schwer es früher Frauen hatten (manchmal auch heute noch, in anderen Ländern sowieso). Von daher kann ich beispielsweise gut verstehen, wie angebracht die Forderung der englischen Schriftstellerin Virginia Woolf ist, dass Frauen in einer Wohnung ihr „own room“, ihr eigenes Zimmer, haben sollten.
SZ: Fühlen Sie sich in Ihrer Ehe als Frau benachteiligt? Weber-Reich: Nein.